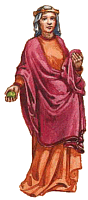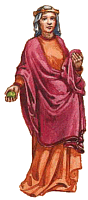Mediävistik - Eine politische Wissenschaftsgeschichte
(19. und 20. Jhd.)
Man spricht heute oftmals über "die anhaltende Krise der Geschichtswissenschaft"
dies gilt auch für die Mediävistik, die früher einmal als Glanzwerk der deutschen
Geschichtsforschung Vorreiter war.
Seit ein paar Jahren, leidet die Mittelalterforschung in Deutschland an Innovationslosigkeit,
lediglich in den traditionellen Feldern, der Textkritik und Quellenedition, ist
Internationales Interesse an der deutschen Mittelalterforschung sichtbar.
Im 19. Jhd. widmete sich die Mittelalterforschung ausgiebig der "quellenkritischen
Grundlagenforschung" und gab so einen Pfad vor, der bis in die Gegenwart nachwirkt.
So sind dies die "traditionellen" Denkmuster im Kopf jedes Mediävisten
Der Beginn der Mittelalterforschung und das Bild das wir, teilweise, noch heute
vom Mittelalter haben, entstand zusammen mit dem Kaiserreich und blieb auch lange
Zeit nach seinem Verfall unangetastet.
Allerdings ist die Mittelalterforschung damals nicht aus reinem wissenschaftlichem
Interesse entstanden, sondern stand in engem Bezug zu den zeitgenössischen politischen
und gesellschaftlichen Entwicklungen (soziopolitische Bezüge).
So das man im 19. Jhd. durchaus von einer "politischen Wissenschaft" sprechen kann.
Nun stellt sich für uns die Frage warum die Mediävistik für die damalige Zeit
politisch entscheidend war.
Ein Grund der sich uns bei einem Blick auf die "Geschichte" der Mittelaltergeschichte
eröffnet, ist die Idee von der Schaffung eines starken deutschen Nationalstaates.
Der Adel wie auch die Bürger fanden in der angeblichen Blütezeit des Reiches, im
Mittelalter, eine Bestätigung ihrer Idee.
So entstand im Jahre 1819, gestützt vom geschichtlichen Interesse der Bevölkerung
und gegründet durch den Freiherren von Stein, die "Gesellschaft für ältere deutsche
Geschichtskunde", deren Aufgabe es war Sammlungen von historiographischen Quellen
zur Geschichte des dt. Reiches (ca. 500 - 1500) zu erstellen um die Nationalstaats
Idee weiter zu fördern. Die wichtigste Errungenschaft dieser Gesellschaft war wohl,
und ist auch heute noch, die "Monumenta Germaniae Historica" die sich als Edition
mittelalterlicher Quellen zur deutschen Geschichte versteht. Geprägt wurde sie
maßgeblich durch Georg Heinrich Pertz.
Die anfänglichen politischen Vorbehalte gegen diese private Einrichtung verloren
sich seit den 1830er Jahren als die "Steinsche Gesellschaft" sich mit dem Kreis
um Leopold Ranke zusammenschloss. Das so entstandene Streben nach Objektivität und
Anwendung der neuen methodischen Quellenkritik, verhalf der Mediävistik dazu als
DIE anerkannte Fürhungsdisziplin der Geschichtswissenschaft zu gelten.
In den 40er Jahren zog die Neuere Geschichte zwar nach, konnte aber mit der
Mediävistik nicht gleichziehen.
Nach der Revolution 1848 erhielt die Mittelalterlicheforschung eine "nationale Mission",
sie sollte der Nationalstaatsidee mit der mittelalterlichen Reichsgeschichte
historisch begründen und legitimieren.
Auch hier zeigte sich wieder die Politikmache der Mediävistik, nehmen wir als
Beispiel den Streit von Heinrich von Sybel und Julius Ficker. Im Fordergrund des
Streites stand die Diskussion darüber ob das mittelalterliche Kaisertum wegen der
Verbindung mit dem Papsttum geschwächt wurde und so zerfiel. Der Grund dieses Streits
lag aber mehr im Moment. Ficker der die Verbindung mit dem Papsttum gut hieß und
die christlich imperiale Universalmonarchie unterstützte sprach sich so gleichzeitig
für die "großdeutsche Lösung aus" und untermauerte seine Meinung mit dem Mittelalter.
Von Sybel hingegen zog die "kleindeutsche Lösung vor" und las aus den gleichen Quellen
das Scheitern einer universalen Imperialpolitik im Mittelalter und auch für seine
Zeit. Durch diese Politisierung gewann die Mediävistik ein besonderes Ansehen als
"nationale Bildungsinstanz".
Nach der Schlacht bei Königgrätz fand zwar dieser Disput sein Ende, die Funktionalisierung
der Mittelalterwissenschaft wurde aber weiter fortgesetzt.
Die 50er Jahre des 19. Jhd. waren eine Blütezeit für die Geschichtswissenschaft.
Durch das weiter angestiegene Interesse an der Geschichte wurden Arbeiten auf diesem
Gebiet stark unterstützt. So konnten die Arbeiten an den "Jahrbüchern der dt. Geschichte"
fortgesetzt sowie neue Projekte (Deutsche Reichsakte, Chroniken dt. Städte Hanserecesse
und Germania Sacra usw.) begonnen werden. So wurden Quellenwerke geschaffen, deren
Wert bis in die heutige Zeit in der Forschung unbestritten ist.
Als 1871 das deutsche Kaiserreich gegründet wurde, war das oberste Ziel erstmal
erreicht und Historiker wie von Sybel freuten sich über die Bestätigung ihrer Argumentation.
Zur etwa gleichen Zeit entstand den Mediävisten ein neues Feindbild, die "Zeitgeschichte",
die durch die Veränderungen in der Gesellschaft und Wirtschaft an Popularität gewann.
Gleichzeitig fand eine Teilung in mittlere und neuere Geschichte statt und es entstanden
Spezialdisziplinen wie die Soziologie, welche die Mediävisten, so glaubten sie,
unter Profilierungszwang stellten, um ihren Elitestatus beizubehalten.
Als dann noch Anhänger Sozialistischer und Materialistischer Weltbilder in die
Öffentlichkeit treten fühlen sich die Historiker, besonders die Mittelalterforscher,
offen angegriffen. Man glaubt diese neue Bewegung nur mit einem Bündnis zwischen
Adel und Bürgertum begrenzen zu können und beginnt das Spezialwissen als akademische
Lehren zu vermitteln.
Die formalen Arbeitstechniken der Mediävisten setzten sich wieder durch und so
waren sie meist für die Ausbildung der Lehrer an Gymnasien und Realschulen sowie
der bürgerlichen Bildung der höheren Bürokratie (Justiz- und Medizinalwesen) zuständig.
So versuchten sie ihr Ideal vom Nationalstaat zu erhalten und verhinderten jeden Versuch,
tief greifende gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen.
So wurden auch Privategesellschaften - vor allem die MGH - in halbstaatliche
Körperschaften umgewandelt und die Geschichtsvereine unter einem Gesamtverein zur
Förderung deutscher Altertumsvereine zusammengeschlossen.
Trotz dem in den 70er Jahren die Zahl der Publikationen in der Mediävistik weiter
stieg, war festzustellen das es eine Konzentration auf wenige Gebiete gab die
besondere Beachtung fanden (zeitliche Konzentration auf die Reichsgeschichte von
der sächsischen bis zu den staufischen Herrschern gab, und thematisch meist die
traditionelle Verfassungsgeschichte und die Historie des Kaiserturms, Königsherrschaft,
Ostsieldung des Bürgertums, Geschichte des mittelalterlichen Städtewesens, Entwicklung
der Kommunalen Autonomie und der städtischen Wirtschaft, Historie der Hanse und
der großen Handelshäuser [waren Beispiele für bürgerliche Durchsetzungskraft die
für das Bürgertum wieder tagespolitisch funktionalisiert wurden]). Diese Einschränkung
der Untersuchungsfelder und Forschungsgegenstände geschah natürlich nicht zufällig,
für die staatstragenden Mittelalterforscher hatte allein der Staat im Mittelpunkt
der historischen Forschung zu stehen. So wandte man sich vor allem der Verfassung, Verwaltung
und Wirtschaft als Untersuchungsfeldern zu. So das die Rechte des Individuums dem
Staat untergeordnet wurden und die Bestrebungen die dem staatlichen Zentralismus
entgegenliefen prinzipiell als Fehlentwicklungen galten.
(Orientierung am zeitgenössichen zentralistischem Nationalstaat)
Dies galt auch für die kirchliche Einmischung in den politischen Machtbereich.
Dies hatte zur Folge das eine Reihe von Wissenschaftlern sich dazu berufen sahen,
eine rein politische Geschichtsschreibung durchsetzen zu wollen (z.B. Georg von Below)
Diese "Polithistoriker" verwarfen die Kulturgeschichte mit sozial geschichtlichem
Hintergrund als völlig verfehlt. Sie sahen darin ein verderbliches Ideengut, das
"Pazifismus, Kosmopolitismus und Internationalismus begünstigte".
Der Sieg dieser Polithistoriker hatte gravierende Konsequenzen für die weitere
Entwicklung der Mediävistik, er verhinderte eine sozialhistorische Forschung in
Deutschland und unterstützte nur die an den politischen Leitvorstellungen des
Kaiserreiches geknüpfte Forschung.
So "verkam" die Mediävistik in der wilhelminischen Zeit zu einer konservativen
Wissenschaft die sich gegen alles Gesellschaftliche wand. Als Folge dessen entwickelte
sich die Sozialgeschichte nur in weiten Teilen Westeuropas und den USA und wurde
auch nur dort weiter entwickelt.
Auch die Nationalsozialisten missbrauchten das Mittelalter für ihre Zwecke, so
postulierten sie die "Kontinuität" vom ersten zum dritten Reich und versuchten so
erneut ihre Ideen zu legitimieren.
Allerdings ist die Rolle der Mediävisten im Nationalsozialismus noch nicht sehr
weit erforscht worden.
Man kann aber davon ausgehen, dass die Mehrzahl der mediävistischen Arbeiten aus
der Zeit des Nationalsozialismus nicht von faschistischen Gedanken geprägt war
und dass das System der Fragestellung bis in die 50er und 60er Jahre wirksam blieb.
Man hat bis dahin die Forschung im dritten Reich als "wissenschafsethische Herausforderung"
gesehen und nicht die Möglichkeit neue Forschungsbereiche und Methoden zu entwickeln.
Auch wenn seit dem neben der verfassungsgeschichtlichen Fragestellung endlich die
Zuwendung zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte gelang, sowie auch eine engere
Zusammenarbeit mit den Sozialwissenschaften. Dies geschah aber erst in den 60er
Jahren durch eine neue und jüngere Generation von Mittelalterforschern.
Karin Hötzl 2006
 |
Quelle:
Berg Dieter, Mediävistik - eine "politische Wissenschaft",
in: Geschichtsdiskurs. Grundlagen und Methoden der Histographiegeschichte,
Küttler Wolfgang, Rüsen Jörg, Schulin Ernst (Hrsg.) Fischer Taschenbuch Verlag 1993
S. 317 - 330  |
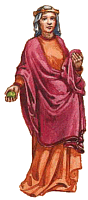 |